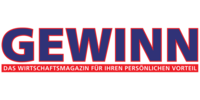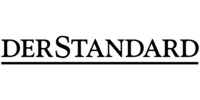Transkript zum Nachlesen und Suchen
Ich agiere wirklich antizyklisch und wenn Krisen eintreten. Ich warte sozusagen auf Sonderangebote. Die Volatilität im positiven Sinne, also die Abweichung nach oben, ist deine Rendite. Und deswegen denken wir uns, das ist sicher, da kann ja nichts passieren. Kapitalflucht ist natürlich das Empfohlene. Wie ist die Rolle von künstlicher Intelligenz im Risikomanagement beim Investieren? Praktisch veranlagt, der Podcast für alle, die Finanzen lieber selber machen. Mit praktischen Veranlagungstipps aus der Veranlagungspraxis. Hallo, mein Name ist Michael und ich stelle stellvertretend für euch naive Fragen zum Thema Geld und Geldanlage. Und unser Finanzprofi Marcel liefert schlaue Antworten aus der Praxis.
Genau Michi, ich versuche es zumindest. Der Grund ist ganz einfach, damit dir mehr Geld bleibt. Wir arbeiten beide für fynupp, dem Marktvergleich für Geldanlage in Österreich, haben also wirklich Einblick und den Überblick über den Markt. Und unser Thema heute: Risiko sparen. Was ist riskanter, sparen oder investieren? Wo liegen da die Risiken, welche Risiken gibt es? Und dann gibt es wieder vier Themen, vier Hauptthemen. Und das erste Thema ist die Risikowahrnehmung. Wie beeinflusst unsere eigene Wahrnehmung das Verständnis von Risiko? Da gibt es verschiedene Risiken, vor manchen fürchten wir uns, vor manchen beachten wir gar nicht, manche kennen wir gar nicht. Was gibt es da für Unterschiede in der Risikowahrnehmung, Marcel?
Also vielleicht das Erste, was man aufgreifen kann, ist ganz klar das Wertschwankungsrisiko. Das heißt, die Menschen tendieren einfach dazu, dass sie Schwankung am Kapital nicht haben möchten. Bestes Beispiel: Viele, viele, viele sparen am Sparbuch. Und wenn ich das im Sparbuch mache, habe ich keine Wertschwankung. Wenn ich jetzt zum Beispiel am Kapitalmarkt investiere, habe ich Wertschwankung. Und diese Wertschwankung nach oben und nach unten geht ja langfristig dahin. Der Unterschied ist, am Sparbuch habe ich ganz, ganz geringe Zuwächse und am Kapitalmarkt habe ich höhere Zuwächse, aber mit Schwankung. Und wir tendieren eben dazu, zu weniger Schwankung sozusagen zu gehen. Das Problem dabei ist, irgendwo zwischen den beiden, also Sparbuch und Kapitalmarkt, gibt es die Inflation. Und die Inflation ist die Kaufkraft. Und am Sparbuch verliere ich Kaufkraft, am Kapitalmarkt gewinne ich langfristig Kaufkraft. Und das heißt, das Marktschwankungsrisiko ist einfach für uns etwas sehr, sehr Unschönes und vor dem fürchten wir uns.
Also bei der Börse geht es immer rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter, aber langfristig stetig nach oben. Aber halt immer rauf und runter, rauf und runter. Und vor diesem rauf und runter und rauf und runter fürchten wir uns. Und beim Sparbuch geht es ganz langsam immer gleich dahin und nicht so weit nach oben. Aber es geht halt nicht rauf und runter. Und deswegen denken wir uns, das ist sicher. Da kann ja nichts passieren. Und wie du richtig sagst, genau zwischen den Zweien ist die Inflation. Aber wenn ich die Inflation schlagen will, und das will ich, dass mein Geld gleich viel wert ist in Zukunft wie heute, dann verliere ich Geld.
Und das wollen wir auf keinen Fall. Und vor allem langfristig ist so ein Risiko auf die Kapitalmärkte sehr gut einzuschätzen. Kurzfristig nicht. Das heißt, es hat beides Berechtigung. Wenn ich hohe Planungssicherheit brauche, also sehr kurzfristig, ab ins Sparbuch. Aber beim langfristigen Investieren, das heißt Vermögensaufbau, hat das Sparbuch natürlich zwar wieder hohe Sicherheit, hat aber nichts mit Vermögensaufbau zu tun. Das heißt, reines Sparen auf zum Beispiel 15 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre wird zu einem Kaufkraftverlust führen, weil ich überhaupt kein Risiko, nennen wir es auch so, oder Wertschwankungsrisiko eingehe, obwohl ich das über 15, 20, 30 Jahre super managen kann.
Okay, das war diese Risikowahrnehmung. Wie unterschiedlich nehmen wir die Risiken wahr und wie sehr stimmt es dann mit der Realität überein? Das nächste ist die Risikobewertung, ist auch ein wichtiger Punkt. Wie werden die Risiken am Kapitalmarkt eigentlich bewertet? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Und zwar, da gibt es ein rechtliches Bewertungsschema. Das heißt, man kann es einfach den Summer Risk Indicator, das ist das, was in Europa und Amerika anerkannt ist, ist nichts anderes wie die Wertschwankung, Volatilität oder die Standardabweichung wird gemessen und desto höher diese Standardabweichung ist, desto risikoreicher wird das Finanzinstrument, das Investment bewertet. Das heißt, Risiko wird fachlich ganz, ganz oft nach der Wertschwankung eingeteilt. Das ist jetzt natürlich teilweise ein bisschen trügerisch, weil auf der einen Seite Volatilität ist ja nichts anderes wie die Abweichung von der Norm. Nach oben heißt es Rendite, nach unten heißt es Verlust. Das heißt, ein Investment, das stetig Plus macht, immer Volatilität nach oben zeigt, ist durchaus riskant auch eingestuft. Das gleiche trifft natürlich auf Volatilität nach unten, also Verluste zu.
Also es wird tatsächlich nur die Volatilität bewertet. Das heißt, wie sehr ein Index, eine ETF, eine Aktie schwankt nach oben und unten. Das bestimmt das Risiko.
Genau, und da gibt es dann Risikoklassen, die sind von 1 bis 7 definiert. Da ist man von 0 bis 1 zum Beispiel in der 1er, von 1 bis X in der 2er und so weiter. Das geht dann rauf auf zum Beispiel 25, 35, 50 Prozent. Da wird es dann hoch spekulativ und so werden wirklich dann Investments oder Finanzinstrumente bewertet und nach Risiko eingestuft. Allerdings macht es einen riesen Unterschied, wenn jetzt ein Finanzprodukt zum Beispiel die Schwankung auf zwei Jahre misst oder ob ich sie auf 30 Jahre messe. Das heißt, es ist natürlich extrem relevant, wie lange ich so ein Investment halte. Da kommen wir ja wieder zu dem Punkt von vorhin. Wenn ich jetzt zu 100% in den Aktienmarkt auf zwei Jahre gehe und die haben irgendwo eine Schwankungsbreite von 30%, würde ich sagen, ist das hoch riskant. Wenn ich das allerdings über 30 Jahre mache und sich diese Schwankung ausgleichen kann, dann hat das mit hoch riskant wenig zu tun.
Okay, es ist eine Frage der Zeit sozusagen.
Genau, es wird rechtlich immer mit der Volatilität gemessen. Allerdings muss man einfach verstehen, dass Volatilität nichts Schlechtes ist. Die Volatilität im positiven Sinne, also die Abweichung nach oben, ist deine Rendite und die Volatilität nach unten sind deine Verluste. Das heißt, es ist ein zweischneidiges Schwert und Verluste können ja langfristig auch durchaus Potenzial bieten, wenn man einfach vielleicht mal zu günstigen Kursen mit einem Sparplan einkaufen darf.
Tatsächlich wird das Risiko nur mit diesem einen Risiko, nämlich dem Wertschwankungsrisiko, bewertet. Aber es gibt ja noch andere Risikoarten. Nächster Punkt. Welche Risiken gibt es denn überhaupt am Kapitalmarkt? Weil das Wertschwankungsrisiko wird ja nicht das eine sein, obwohl es das einzige ist, das tatsächlich zur Risikoeinstufung verwendet wird. Das muss man auch bedenken.
Absolut. Und da muss man ja sagen, es wird ja jedes Finanzinstrument als Einzelnes bewertet. Also es wird das Risiko einer Aktie bewertet. Es wird das Risiko eines ETFs, eines Fonds bewertet. Es wird das Risiko eines Portfolios, da können ja auch unterschiedliche Dinge drin sein, bewertet. Also da gibt es dann einfach Abstufungen, sozusagen Grauschattierungen. Und du hast dann schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Es gibt aber andere Risiken und da haben wir uns heute vor allem mit Zwei wichtigsten höchstwahrscheinlich rausgepickt. Es gibt noch viele weitere, aber ich glaube, das ist einmal ganz, ganz wichtig zu verstehen. Auf der einen Seite das Marktrisiko und auf der anderen Seite das unsystematische, idiosynkratische, nichts anderes wie das Unternehmensrisiko.
Also auf das Einzelne bezogen.
Genau. Und was macht wirklich das Unternehmen? Zum Beispiel die Aktie, die ich habe. Und dass man sich das vorstellen kann, der Markt selbst trägt ein Risiko. Wir können uns das am besten mit einer Branche vorstellen, sagen wir die Branche X oder die, wenn wir im Finanzsektor sind, der Finanzsektor ist der Markt. Und dem Finanzsektor als Ganzen kann es gut oder schlecht gehen. Je nach Marktphase wird es immer auf und nieder gehen für den kompletten Sektor, kompletten Markt, also die Finanzbranche. In diesem Sektor gibt es aber natürlich Unternehmen, die den Sektor ausmachen. Da gibt es von mir aus zehn Finanzinstitute und den einen geht es manchmal besser wie den anderen. Das ist dann sozusagen das unsystematische, also wirklich das unternehmensbezogene individuelle Risiko. Das kann auf unternehmensspezifischer Ebene sein. Vielleicht brauchen sie einfach Kapital. Vielleicht haben sie andere Risikoanforderungen. Vielleicht haben sie bessere Margen. Einem Unternehmen geht es besser wie den anderen teilweise. Und der Markt als Ganzes, der ist aber eher von makroökonomischen sozusagen Mustern geprägt, wenn sich die Leitzinsen verändern, wenn jetzt einfach ein allgemeiner Wirtschaftsaufschwung oder Rezession oder Abschwung besteht. Das heißt, dort hat man zwei unterschiedliche Risiken und so kann man das kategorisieren.
Und die Risiken können sich ja auch ändern. Die bleiben ja nicht gleich. Wie sich alles im Leben verändert. Wie können jetzt Anleger, Sparerinnen und Sparer auf sich verändernde Risiken reagieren? Was kann man da machen?
Also das Erste vielleicht noch zum Marktrisiko und unsystematischen Risiko. Das ist nicht starr. Das Marktrisiko muss ich tragen. Das unsystematische Risiko kann ich wegdiversifizieren. Haben viele Leute schon gehört. Ist nichts anderes, wenn ich mehrere Unternehmen kaufe und es ist nicht ganz intuitiv. Und dann trage ich nicht den Durchschnitt des Risikos, sondern das Risiko nimmt mit der Diversifizierung ab. Und irgendwann, wenn ich genug diversifiziere, lande ich beim Marktrisiko.
Du hast nicht nur ein Unternehmen in deinem Portfolio, sondern mehrere. Nicht nur ein Finanzmarktunternehmen, sondern mehrere. Nicht nur Finanzmarktunternehmen, sondern aus unterschiedlichsten Branchen. Und so minimiert sich dein Risiko immer mehr. Das macht dann immer so viel, wenn unternehmensspezifische Risiken schlagend werden, sozusagen.
Absolut. Also man kann zum Beispiel, es gibt ja das Totalverlustrisiko. Man braucht sich nur vorstellen, in einer Branche geht ein Unternehmen unter. Wenn ich die ganze Branche gekauft habe, dann stört mir das in meinem Portfolio nicht. Habe ich aber nur ein Unternehmen gekauft, dann stört mir das auf jeden Fall. Und deshalb sollte man eben stark diversifizieren. Du kommst ja schon zum nächsten Thema, was können da Menschen wirklich tun, um solche Risiken zu managen. Im Bestfall an der Strategie festhalten. Das heißt, Risikomanagement langfristig geht meist in die Hose. Das heißt, wenn man auf Marktänderungen reagiert, dann macht man das immer. Nach der Änderung, also nachdem so eine Veränderung sozusagen für den Markt eintritt, reagiere ich darauf. Das heißt, ich bin immer einen Schritt hinterher. Ist jetzt nicht die beste Idee, immer einen Schritt hinterher zu sein. Deshalb an der Strategie festhalten, wenn es eine langfristige Strategie ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel weiß, okay, man muss wirklich in zum Beispiel fünf, zehn Jahren Kapital schon auszahlen, also man benötigt das Kapital. Dann einfach wirklich nur einer auch fixen Strategie das Risiko langsam rausnehmen. Langsam die Aktienquote senken, die Anleihenquote oder Geldmarktquote erhöhen. An dieser Strategie festhalten, weil es kann dir keiner sagen, wann das Risiko wieder geringer oder wieder höher wird. Es würde da noch von wissenschaftlicher Ebene gibt es noch eine andere Option. Und zwar ist das, dass man allgemein antizyklisch agiert. Das heißt, man ist nie zu 100 Prozent. Oder von Grund auf nicht zu 100% investiert. Also ich habe zum Beispiel 1.000 Euro. Ich sage aber, ich investiere nur 800 Euro in den Aktienmarkt. Und nur wenn jetzt wirklich Risiken am Markt auftreten, das heißt die Kurse einbrechen, dann kaufe ich nach. Das heißt, ich agiere wirklich antizyklisch. Und wenn Krisen eintreten...
Ich warte sozusagen auf Sonderangebote.
Genau, dann die Krisen nütze ich als Chance. Und wenn die Krisen da sind, das kann zum Beispiel ein Einbruch von 20% sein, dann Höhe auf 90, bei 50% Einbruch auf 100. Das kann man sich dann mit empirischen Daten anschauen. So kann ich dann antizyklisch wieder agieren. Und wenn die Kurse wieder anziehen, also vielleicht ein neues All-Time-High erreichen, dann reduziere ich die Aktienquote wieder und bereite mich vor, dass ich zukünftig wieder antizyklisch reagieren kann. Verstehe.
Ja, sehr gut. Das ist eigentlich ein guter Plan. Also nicht zu viel reagieren und wenn, dann nur einer Strategie folgen.
Genau.
Man muss nicht gleich auf jedes eintretende Risiko mit Kapitalflucht reagieren.
Kapitalflucht ist natürlich das Empfohlene. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn die Börsen einbrechen, Geld abziehen, fünf Jahre warten, ja nicht aktiv investieren und dann einsteigen. Einsteigen, wenn es wieder oben ist. Einsteigen, wenn es teuer ist. Es gibt den bekannten Spruch von Warren Buffett, ich glaube, jeder hat ihn schon vielleicht mal gehört, mit Time in the Market beats Timing in the Market. Das trifft für professionelle Privatanleger für nahezu alle zu. Im Markt bleiben, der Strategie folgen und nicht wegen alles in Panik ausbrechen.
Apropos Panik. Viele sind ja jetzt in Panik wegen der künstlichen Intelligenz, die alle Lebensbereiche nach und nach zu durchdringen droht. Und die gibt es natürlich auch in der Finanzbranche. Gute, schlechte, man weiß es nicht, alte, neue Anwendungen. Und einer davon ist ja auch das Risikomanagement, weil wir beim Risiko sind. Wie ist die Rolle von künstlicher Intelligenz im Risikomanagement beim Investieren?
Ich glaube, das wird sehr, sehr interessant, weil Risikomodelle bauen auf vergangenen Daten auf. Da gibt es weitaus mehr Risikokennzahlen noch. Da gibt es Drawdowns, also wie viel Verlust ich zukünftig erwarte, wie viel Verlust ich derzeit auf mein Kapital verkrafte. Und das wird anhand von vergangenen Daten berechnet. Da gibt es auch schon Maschinenlernmodelle dazu. Und das Interessante an der KI kann natürlich sein, dass die komplett emotionslos und rational, ohne sozusagen menschliches Einwirken, diese Modelle anpasst. Inwieweit es die KI zukünftig kann, also diese Modelle, was jetzt schon bestehen und nicht immer ganz so super funktionieren, wie wir wissen, verbessert, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Es wird die Zeit zeigen. Im Endeffekt ist es nichts anderes. Wir werden schlauer, wenn die KI schlauer wird und umgekehrt. Und wir hoffen natürlich, dass irgendwann ein Risikomodell entwickelt wird, was das fade Durchhalten am Markt schlägt. Es ist aber wahrscheinlich noch ein weiter Weg dorthin.
Ich verstehe. Aber sie hätte auch Vorteile, weil du gesagt hast, rational, sie ist emotionslos und vor allem auch schneller als wir.
Genau, absolut. Also es passiert ja mittlerweile alles instant. Es gibt dann, wenn jetzt zum Beispiel ein Risikoindikator ausgelöst wird, sagen wir es kommt zu einem Crash an der Börse und da sitzt man bei einer Kapitalanlagegesellschaft, wird es wahrscheinlich dann zu einem Investors Meeting kommen. Da wird darüber entschieden und da werden verschiedene Meinungen eingebracht. Die KI kann solche Entscheidungen relativ flott treffen und die Frage ist, ob dann auch vielleicht sogar mehr Objektivität drin ist, weil natürlich überall Interessen mitfließen. Jeder hat andere Argumentationen. Ich glaube, desto mehr Emotionen man aus dem Investmentbereich auslöschen kann, desto besser wird es für die AnlegerInnen sein.
Die große Gefahr, selbst bei Profis, ist die Emotion. Absolut.
Wir haben ja auch Podcasts zu finanziellen Irrtümern. Es gibt eben diese Biases oder einfach diese Gewohnheiten, was man hat, dass man tendiert, den Trend hinterherzulaufen, dass man tendiert, in das zu investieren, was man kennt. Also dieser Home-Bias zu Hause, da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Wir sind eben Menschen mit Emotionen, was gut so ist. Beim Investieren dürfen wir uns nicht immer darauf verlassen. Deshalb KI extrem interessant.
Angst ist ja auch eine ganz große Emotion. Die haben die Leute ja nicht nur vor KI, sondern auch, und das bringt uns zur Frage aus der Community, Angst vorm Starten. Und die Frage aus der Community ist tatsächlich, ich will auch starten, wie gehe ich mit der Angst vor großen Verlusten um, ist die Frage. Und tatsächlich passt es auch gut. Weil es mit Risiko zu tun hat. Das Risiko des Verlustes. Wie gehe ich damit um? Wie kann jemand starten, der anfangen will?
Also es ist eigentlich, man kann sich die Frage so stellen, du hast zwei Optionen. Du hast entweder ein risikoloses Investment oder ein Investment mit Risiko. Das Risikolose bietet dir langfristig eine fixe, negative, reale Rendite. Das heißt, du wirst immer Kaufkraft verlieren. Wenn du das haben möchtest, musst du das machen. Nur du hast die Gewissheit, dass du Verlust hast. Auf der anderen Seite hast du eben die Gewissheit, dass Kapitalmärkte fixe, positive, reale Renditen langfristiger wirtschaften. Aber du hast Risiko damit einhergehend. Und ich glaube, die schönere Antwort ist allen klar, dass man natürlich beim Investieren lieber Gewinne als real mehr hat. Und wenn man jetzt in Krisenzeiten schlittert, gilt es einfach, dass man an die Strategie denkt, so fad es klingt. Wenn man vielleicht auch mit Freunden darüber redet, mit Bekannten, mit Beratern, mit Experten, dass man sich wirklich auf das Wissenschaftliche, auf die Basis fokussiert und nicht, dass man jeden Newsartikel als nächstes Horrorszenario sozusagen vor Augen gehalten bekommt.
Okay, also auch langfristig quasi die Verluste nicht als, also kurzfristige Verluste können sich langfristig ausgleichen, das muss man halt einfach wissen.
Genau, also bitte einfach nur investieren und das ist ja das Wichtige, wenn man weiß, welche Risiken damit einhergehen. Und das Investieren ins Sparbuch hat einfach das Risiko, dass sich Kaufkraftverlust zumindest in den letzten 50 Jahren fix gehabt habe. Das wird sich wahrscheinlich in der Zukunft auch nicht so schnell ändern. Am Kapitalmarkt habe ich natürlich das hohe Wertschwankungsrisiko. Dafür habe ich das Zuckerl auf der anderen Seite von positiver realer Kaufkraftsteigerung. Und das gilt es abzuwägen. Ist für jeden natürlich individuell und hängt auch von der Laufzeit ab.
Okay, aber Wissen ist glaube ich Wissen beruhigt.
Zumindest mich.
Sehr gut. Dann kommen wir zum letzten Teil. Du hast immer einen praktischen Veranlagungstipp aus der Veranlagungspraxis, passend zum Podcast-Titel. Was ist heute dein praktischer Veranlagungstipp, Marcel?
Sparen ist langfristig riskanter als investieren, wenn es qualitativ hochwertig ist. Das heißt ganz einfach gesagt, wenn du nur sparst, dann wirst du langfristig schlechter aussteigen, wie jemand, der sich einmal die Zeit nimmt und mit dem auseinandersetzt. Eine qualitativ hochwertige Strategie mit passenden Produkten und Instrumenten, also Fonds, aufsetzt, so kannst du dann wirklich die zurücklehnen und ordentlichen Vermögensaufbau betreiben.
Das ist interessant, weil tatsächlich glauben ja die Leute, das habe ich auch bis vor kurzem geglaubt, das ist ja umgekehrt. Sparen ist das Nicht-Riskante. Ja, also genau umgekehrt, wie man so glaubt. Und da kann jeder was dazulernen. Das ist ja auch das Ziel unseres Podcasts. Ein spannendes Thema heute aufbereitet. Risiko sparen, was ist riskanter? Sparen oder investieren? Jetzt wissen wir es. Ich sage danke fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, runtergeladen habt, gestreamt habt, uns vielleicht sogar zugesehen habt, weil diesen Podcast gibt es nicht nur als Audio, sondern auch als Videopodcast auf Spotify und YouTube. Vielen Dank. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Ladet wieder runter. Wir haben jede Woche spannende Themen rund ums Thema Geldanlage und Geld. Und ich stelle naive Fragen. Marcel gibt praktische Antworten aus der Praxis. Und dann hören wir uns wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba.
Bis zum nächsten Mal.
Praktisch veranlagt. Der Podcast für alle, die Finanzen lieber selber machen.