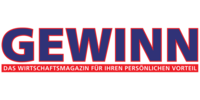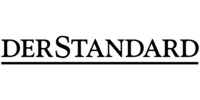Transkript zum Nachlesen und Suchen
Dass es tatsächlich zu einem Zahlungsausfall in den USA kommen könnte, würde natürlich Konsequenzen für andere Industrienationen und unser Geldsystem im Allgemeinen haben. Ein solcher Zahlungsausfall hat es seit der Nachkriegszeit noch nicht gegeben. Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher zu unserem heutigen Webinar. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema vor uns: Geldsystem und Inflation. Ich habe folgende Punkte vorbereitet: die Funktionen und die Hüter des Geldes, also wer die Hüter des Geldes sind und welche Funktion das Geld eigentlich hat. Dann schauen wir uns an, wie es vor der internationalen Währungsordnung von Bretton Woods vor 1944 war. Was ist da alles passiert? Ein sehr spannender Bereich, den wir nur kurz streifen können. Dann kommt das Bretton-Woods-Abkommen. Was bedeutet es? Es war die internationale Währungsordnung, die hier geschaffen wurde. Diese Ordnung zerfiel 1971, offiziell 1973. Warum und wieso, das schauen wir uns an. Seitdem leben wir im sogenannten Fiat-Geld und haben eine steigende Geldmenge. Was heißt eine steigende Geldmenge? Was hat das mit der Inflation zu tun? Das schauen wir uns dann an. Dann kommen wir zur großen Finanzkrise 2008. Und zu guter Letzt schauen wir uns die aktuelle Lage und die Aussichten an. Es ist ja sehr spannend derzeit rund um die USA, Donald Trump, die Zölle, Handelskriege. Das beschäftigt uns natürlich. Wie geht es da weiter? Was soll man tun? Und bevor wir mit dem Thema starten, noch der obligate Haftungshinweis. Dieses Webinar ersetzt natürlich keine Beratungen. Wir bieten Beratungen an. Online-Honorarberatungen können jederzeit bei uns gebucht werden. Die ersten 30 Minuten sind sogar kostenfrei. Auch eine Haftung für die im Webinar verwendeten Folien und Unterlagen können wir nicht geben. Wir haben so gut wie möglich recherchiert. Und ganz wichtig, Performancergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die Zukunft zu. Die Zukunft kennen wir genauso wenig wie alle anderen Marktteilnehmer. So, dann haben wir diese Pflicht erfüllt und können im Prinzip schon starten mit dem ersten Thema. Es ist wichtig, dass man Geld versteht und dazu ist es besser, wenn man sich mal ein bisschen in die Vogelperspektive begibt, um ein bisschen in die Geschichte zu blicken und damit wir aus der Geschichte bestmöglich lernen können. Damit wir in der Gegenwart Handlungen setzen, die dazu führen, dass wir für die Zukunft besser vorbereitet sind. Das ist wichtig. Deswegen sitzen wir heute beisammen und ich freue mich sehr, dass sich so viele von euch heute die Zeit dazu genommen haben. Ich versuche es, wie gesagt, so spannend wie möglich auch zu gestalten, weil für mich selber ist es ein sehr spannender Bereich. So, aber jetzt geht's los. Was sind die Funktionen des Geldes? Was hat das Geld eigentlich für Funktionen? Es ist einmal das gesetzliche Zahlungsmittel. Man bekommt für einen Schein Papier Waren und Dienstleistungen. Das ist nicht so selbstverständlich, dass das jemand gibt. Dazu braucht man immer Vertrauen. Oder in dem Fall ist es einfach gesetzlich geregelt, dass man verpflichtet ist, für einen Geldschein Waren und Dienstleistungen zu geben. Es ist eine Recheneinheit. Eine Recheneinheit, damit tun wir uns viel leichter, Werte zu bestimmen. Wie viel kostet eine Semmel? Wie viel kostet eine Kugel Eis? Wie viel kostet ein Auto? Wir bemessen die Waren und Dienstleistungen mit der Recheneinheit Euro, das ist unser Zahlungsmittel, unser Geld, in dem wir jetzt sind. Und ganz wichtig natürlich für uns als Finanzberater, das Wertaufbewahrungsmittel. Das heißt, wenn ich heute verzichte auf Konsum und für später spare, dann möchte ich natürlich diesen Geldwert möglichst gut aufbewahren. Hier habe ich natürlich die Inflation ein bisschen als Gegenspieler und deswegen muss ich ganz genau aufpassen, wenn ich den Geldwert für später aufbewahren möchte, ist es natürlich ganz wichtig, hier auf den Wert des Geldes zu achten. Was ist die Voraussetzung für funktionierendes Geld? Das A und O, worum sich alles dreht, ist Vertrauen. Weil man vertraut, dass jemand ein Stück Papier oder eine Münze, das grundsätzlich auch keinen Wert hat, dafür gebe ich Leistung in Form von Dienstleistungen oder Waren und Güter. Ich gebe etwas Wertvolles her und nehme dafür Geld. Damit das funktioniert, ist es ganz elementar, dass man vertraut, dass man dafür auch wieder etwas bekommt. Das ist die zentrale Voraussetzung, ist Vertrauen. Und wenn Vertrauen in eine Währung verloren geht, dann endet das in der Regel in HyperInflation und letzten Endes dann auch in Währungsreformen. Werden wir uns heute auch kurz anschauen. Damit Vertrauen in eine Währung entsteht, ist es wichtig, dass ich ein stabiles Währungssystem habe, dass es Stabilität habe. Und für die Sicherung der Stabilität ist eben verantwortlich die jeweiligen Notenbanken. Bei uns die Europäische Zentralbank, in Amerika die Federal Reserve, kurz FED, und in Großbritannien, Japan und so weiter, haben alle großen Wirtschaftsmächte natürlich Notenbanken. Und dann geht es vielleicht auch noch um die Verteilung. Das heißt, wenn nur 10% der Menschen sehr viel Geld haben und 90% der Menschen sehr wenig Geld haben, dann habe ich natürlich einen gewissen Hemmschuh im Geldumlauf. Im Austausch von Waren und Dienstleistungen. Dafür wäre eigentlich verantwortlich die Politik, dass sie im Steuersystem für eine Umverteilung sorgt, damit es hier eben nicht zu so großen Unterschieden kommt, wie es aber tatsächlich immer mehr der Fall ist. Und ja, das ist auch ein Problem, auf das werden wir heute nicht sehr stark eingehen. Das wäre ein eigenes Thema für sich. Aber das Vertrauen, um das wird es heute sehr viel gehen und um die Stabilität. Vor der internationalen Währungsordnung, was ist da passiert? Das ist jetzt ein kurzer geschichtlicher Abriss, dass man einfach ein bisschen eine Einordnung hat, wie unser Geldsystem entstanden ist und was da so passiert ist. Grundsätzlich ist es ja so, dass der Herausgeber des Geldes, derjenige, der Hüter des Geldes ist, sollte er grundsätzlich selbst nie einen Geldbedarf haben. Ansonsten besteht die Gefahr, dass einfach zu viel Geld gedruckt wird. Das erkennt man vielleicht auch schon, wenn man die Notenpresse anwirft, wenn die Notenpresse angeworfen wird, damit man vielleicht Ausgaben leichter tätigen kann, dann ist es immer gefährlich geworden in der Geschichte. Und da müssen wir jetzt ganz genau hinschauen, was da gerade momentan aktuell passiert oder was in den letzten 10, 15, 20, 25 Jahren speziell passiert ist, ob da irgendwelche Gefahren für die Zukunft lauern. Wenn ein Staat die Macht hat über die Menge des Geldes zu bestimmen, dann besteht natürlich wirklich immer die Versuchung, hier diesen leichteren Weg zu gehen, indem man einfach mehr Geld druckt. Die Alternative für einen Staat, für die Finanzierung wäre, dass er Steuern erhöht. Steuern erhöhen ist unpopulär. Da hat man die Gefahr in einer Demokratie, dass man dann nicht wieder gewählt wird bei der nächsten Wahl. Und deswegen muss man mit dem Thema Steuererhöhungen sehr vorsichtig umgehen. Ich glaube, wir in Österreich, das geht ja momentan eh sehr stark durch die Medien, sollte jeder in dem Bereich auch ein bisschen einen Bezug haben zum aktuellen Umfeld. Geld drucken wäre einfach, verursacht aber mittel- und langfristig Probleme. Und so war es auch schon in der Vergangenheit. Hier in der ersten Seile steht, bis 1914 haben wir in Österreich den Goldstandard gehabt. Das heißt, wenn das Zahlungsmittel an etwas gebunden ist, wie zum Beispiel Gold. Gold war halt einfach das Verbindungsmittel in der Vergangenheit schlechthin, weil man Gold nicht beliebig vermehren kann. Das ist im Prinzip der entscheidende Faktor. Gold kann man nicht beliebig vermehren und deswegen hat man sich quasi auferlegt, damit man nicht in die Gefahr läuft, zu viel Geld zu drucken, dass man hier eine gewisse Bindung an Gold eingeht, einfach nur um nicht zu viel vom Geld zu drucken, damit wiederum eine stabile Währung besteht. Dann ist der Erste Weltkrieg gekommen und das Erste, was gemacht wurde, ist natürlich die Auflösung vom Goldstandard. Man hat für die Bezahlung des Krieges mehr Geld gebraucht, als man gehabt hat. Staatsschulden aufnehmen war dann auch natürlich eine Folge des Ganzen und damit man das Ganze finanzieren hat können, braucht man mehr Geld, als man in einem Goldstandard hat und so wird in der Regel in Krisen immer der Goldstandard. Dazu kommen wir dann später dann auch noch einmal. Wie gesagt, wenn hier Fragen entstehen, das könnte schon durchaus sein, dass der eine oder andere Punkt Fragezeichen aufruft, einfach bitte in den Chat oder bei Frageantworten gleich reinschreiben. Nach dem Ersten Weltkrieg 1918 bis 1922 gab es in Österreich und auch in Deutschland die HyperInflation. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon einmal verfolgt hat. Das ist dann von 1918 ist es leicht jedes Jahr immer wieder gestiegen, immer stärker gestiegen. Und dann so 1922 war dann die Geldentwertung so steil. Man hat das Geld, das Bargeld, also tonnenweise. Weil es einfach überhaupt keinen Wert mehr gehabt hat. Und dann hat man natürlich versucht, diese HyperInflation, die ja gleichzeitig wieder zu Währungsschwächen führt, zu stabilisieren. Und das kann man meistens dann wieder stabilisieren, wenn man eine Währungsreform macht. Und so ist 1925 der Schilling in Österreich eingeführt worden. Das heißt, der Schilling hat die Kronen abgelöst. Der Zeitraum von 1925 bis 1929, bis kurz vor der Weltwirtschaftskrise, galt in Österreich und auch in Deutschland als die Gründerjahre, da haben wir wirtschaftlich extrem stark und gut nach oben gegangen, stabile Währung sorgte für gute Wirtschaftsleistungen. 1929 die Weltwirtschaftskrise, ausgelöst durch USA. Hat dann auch dazu geführt, dass 1931 in Österreich immer mehr Banken auch zusammengebrochen sind. Das heißt, so Bankenzusammenbrüche wie in der Finanzkrise 2007, 2008 mit Lehman Brothers, das man in der Regel kennt, hat es auch damals schon gegeben. Der Höhepunkt war der Zusammenbruch der Kreditanstalt 1931 in Österreich. Wurde dann der Schilling durch die Reichsmark ersetzt. Und hier haben die Österreicherinnen schon das erste Mal einen Währungsschnitt erleben müssen. Das heißt, die Reichsmark ist im Verhältnis 1,5 umgetauscht worden. Das heißt, für 1,5 Schillinge hat man eine Reichsmark bekommen. Und dadurch war natürlich das ersparte Vermögen mit einem Schlag schon mal um dieses Verhältnis weniger wert. Das ist immer die große Gefahr auch der Währung. Dann kennen wir den Zweiten Weltkrieg. Und nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 hat es wieder eine Währungsumstellung gegeben von der Reichsmark wieder in den österreichischen Schilling. Da wurde eins zu eins umgetauscht, aber ganz wichtig, nur 150 Reichsmark wurden 150 Schillinge. Und der Rest dieses Geldes ist auf ein sogenanntes Sperrkonto gekommen. Das hat die Regierung damals verwendet für eigene Ausgaben, ist nicht ausgegeben worden. Und 1947 haben wir dann die Währungsreform gehabt. Das Umrechnungsverhältnis war damals 1 zu 3. Das heißt, hier hat man quasi zwei Drittel seines Geldwertes auf einen Schlag verloren. Das passiert immer sehr, sehr schnell. Die Einlösefrist beträgt meistens zwei Wochen. Und innerhalb dieser zwei Wochen muss man dann einfach den alten Schilling gegen den neuen Schilling eintauschen. Und wer das in der Zeit nicht gemacht hat, ist dann wertlos verfallen. Genauso war es in Deutschland bei der Währungsreform 1948. Tatsächlich das Umtauschverhältnis 1 zu 10. Das heißt, hier hat man für 10 Reichsmark nur eine D-Mark bekommen. Das war übrigens auch sehr interessant, weil das natürlich gut vorbereitet werden muss, so eine Währungsreform. Die D-Mark-Scheine sind in Amerika gedruckt worden und sind dann in einer Geheimaktion verschifft worden. Und an einem Sonntag wurde dann verkündet, morgen gibt es die D-Mark. Es ist damals noch überlegt worden, ob es für ganz Deutschland die neue D-Mark eingeführt werden sollte oder nur für Westdeutschland. Man hat sich dann entschieden, nur für Westdeutschland das Ganze zu machen. Und das war im Prinzip der Beginn auch der Teilung Deutschlands, der wirklichen Teilung Deutschlands. Siegermächte so aufgeteilt, aber man hätte durchaus auch die D-Mark auch in Ostdeutschland einführen können, wenn man sich mit der damaligen Sowjetunion abgesprochen hätte. Das hat man nicht getan, man hat es nur in Westdeutschland eingeführt, aber da will ich nicht jetzt zu sehr in die Tiefe gehen und so war im Prinzip das auch schon der Beginn der Teilung Deutschlands durch diesen Umstand. Dass hier eine stabile Währung eingeführt wurde. Und dann war das Bretton-Woods-Abkommen, von dem ich vorher schon zwei, dreimal angesprochen habe, was war das Bretton-Woods-Abkommen? Die Siegermächte haben sich 1944 in einer Konferenz in der gleichnamigen Stadt Bretton-Woods in Amerika darauf verständigt. Da waren 44 Nationen dabei. Es hat schon Vorgespräche natürlich gegeben. Das ist wie meistens der Fall, dass es hier ein, zwei Player gibt. In dem Fall war es Großbritannien und die USA. Großbritannien war ja vor den Weltkriegen die Weltmacht im Prinzip mit dem britischen Pfund. Das britische Empire hat hier im Prinzip die Weltwährung mit dem britischen Pfund und die Weltmacht. Und das hat sich dann einfach verschoben nach den USA. Und nach dem Zweiten Weltkrieg waren im Prinzip die USA dann die große Macht, die dann entschieden hat. Und hier hat es unterschiedliche Vorschläge gegeben, wie man eine Währungsordnung nach dem Zweiten Weltkrieg vereinbaren könnte. Das Ziel war, dass man Handelskriege durch Zölle, Währungsabwertung und Verlassen des Goldstandards verhindert. Das heißt, in den Währungen zuvor, vor dem Bretton-Woods-Abkommen, hat es immer wieder aus Eigeninteresse der einzelnen Währungsnationen auch schon Abwertungen der Währungen gegeben. Es wurden Zölle eingeführt und das kann man natürlich am besten machen, nicht an einen Goldstandard gebunden ist, der ein bisschen unflexibler ist in der Gestaltung, sondern wo ich frei entscheiden kann. Und dieses Abkommen sollte eben das verhindern. Und deswegen wurde diese Konferenz einberufen mit dem Ziel der Schaffung von Wohlstand durch. Und die Initiatoren, habe ich schon gesagt, das war Großbritannien und USA. Der Vorschlag von Großbritannien wurde damals gemacht von John Maynard Keynes, der ja sehr bekannt ist. Und der wollte im Prinzip eine gemeinsame, staatenunabhängige Weltwährung schaffen. An der Spitze der Herr Harry Dexter White hat vorgeschlagen, den US-Dollar zur Leitwährung zu machen. Und ja, man kann sich vorstellen, ich habe es ja hier hergeschrieben, im Leben ist es halt so, dass der Stärkere in der Regel gewinnt. Und der Stärkere war nach dem Zweiten Weltkrieg einfach die USA. Und so hat man sich dann auf Folgendes geeinigt. Man hat gesagt, der US-Dollar wird die Welt Leitwährung. Damit, ich habe vorher schon gesagt, ganz ein wichtiger Teil für eine Geld, für Geld, für die Währung ist Vertrauen. Damit hier Vertrauen besteht in eine Währung, ist es wichtig, dass ich einen gewissen Wert dahinter lege. Und man hat damals bestimmt, dass man eine Unze Gold, die habe ich da in der Hand, in Form von einer Unze Gold Philharmoniker, Man bekommt für 35 US-Dollar eine Unze Gold. Der Umrechnungswert wurde festgelegt. Wie viel ist ein Dollar wert? Man hat gesagt, 35 Dollar entspricht einer Unze Gold. Ein fixer Umrechnungskurs. Und gleichzeitig hat man dann vereinbart, dass alle Währungen der Welt, die an diesem Bretton-Woods-Abkommen teilgenommen haben, das waren im Prinzip alle relevanten Währungen, westlichen Länder, also westlich orientierten Ländern oder alle Länder außer den Sowjetmächten. Im Prinzip, haben sie dann mit einem festen Wechselkurs die eigene Währung an den US-Dollar gebunden. Und dadurch war der Dollar im Prinzip die Weltwährung schlechthin. Und damit das eben nicht ausgenutzt werden sollte, Diese Vormachtstellung oder dieses Privileg, das damit geschaffen wurde, hat eben die USA gesagt, wir können nicht einfach nur die Notenpresse anwerfen, wir können nicht einfach nur beliebig viel Geld drucken, wie wir wollen, weil der Dollar ist ja gebunden an der Unze Gold. Und das sollte Vertrauen schaffen, dass ihr euch, ihr lieben anderen Länder, dass ihr euch an dieses Abkommen. Oder dass ihr daran glaubt, dass ihr jederzeit das umändern könnt. Das heißt, es wurden zwei entscheidende Pfähle eingeschlagen. Zum einen, jede Währung wird zu einem festen Umwechslungskurs an den Dollar gebunden. Und der Dollar hat ein festes Tauschverhältnis. Eine Unze Gold 35 Dollar. So ist es richtig. Und die Mitgliedsländer oder die Länder, die dem Bretton-Woods-Abkommen beigetreten sind, haben jederzeit das Recht, Dollar gegen Gold zu tauschen. So war die Vereinbarung. Nicht nur die Vereinbarung, sondern die Verträge haben im Wesentlichen so gelautet. Ja, und so passiert es in der Geschichte halt sehr häufig, dass zu Beginn etwas gemacht wird, was später nicht eingehalten wird. Und so ist eben auch das Bretton-Wood-System zerfallen. Und zwar hat es schon begonnen. Wie gesagt, 1944 war Bretton Woods und dann sind die Länder mit der Zeit immer so beigetreten. Österreich 1947 nach der Währungsreform, Deutschland 1948 auch nach der Währungsreform und viele andere Länder gleich nach dem Zweiten Weltkrieg. Und bereits 20 Jahre später, im Prinzip 1966, hat hier zu Beginn einmal Frankreich, Frankreichs Präsident de Gaulle, damals den Umtausch von Dollar auf Gold gefordert, weil er schon ein bisschen Zweifel gehegt hat, ob das denn noch möglich ist, dass die Amerikaner hier wirklich dieses Versprechen, dieses vertraglich zugesicherte Versprechen einlösen können, dass für 35 Dollar eine Unze Gold gegeben wird. Zunächst eingeschränkt, 1968 hat man das dann beschränkt. Die Umtauschpflicht hat dann nur mehr unter Zentralbanken gegolten. Dann wurde weiterhin Gold gewechselt oder das ist dann in der Diskussion gewesen. Und dann hat es am 15. August 1971 den sogenannten Nixon-Schock gegeben. Und hier hat der damalige Präsident Nixon Es gibt sehr interessante Interviews auf YouTube und so weiter. Wir haben es auch in einem Artikel. Wir haben einen Artikel, der heißt die wahre Inflation. Und da haben wir auch einen kurzen Ausschnitt von einer ZDF-Reportage verlinkt. Kann man sich vielleicht anschauen. Ich werde dann vielleicht im Anschluss des Webinars auf diesen Artikel kurz hinleiten. Und ja, was ist damals gesagt worden von Richard Nixon? Es gibt eine vorübergehende Aufhebung der Umtauschpflicht. Das heißt, eine der Grundpfeiler wurde aufgehoben. Die Umtauschpflicht zwischen Dollar und Gold wurde einfach aufgehoben. Es war im Prinzip ein einseitiger Vertragsbruch, wo sich aber im Prinzip niemand hat wehren können, weil was sollte man denn machen als Staat, wenn ein anderer sein Versprechen bricht? Man müsste im Prinzip ja dann militärisch vorgehen und dazu war wahrscheinlich niemand bereit und niemand in der Lage und hätte wahrscheinlich auch Gott sei Dank nicht sehr viel Sinn gemacht. Jedenfalls war das der Beginn vom Ende des Bretton-Wood-Systems und 1973 wurde dann das offizielle Ende des Systems beschlossen. Und dann war nicht nur die Aufhebung der Goldbindung vom Dollar, sondern die Bindung der Wechselkurse. Wurde dann auch aufgehoben. Das heißt, dann war jede Währung zu der anderen Währung frei. Ja, und dann beginnt die Zeit des Fiat-Geldes, wie es so schön heißt. Und das Wort Fiat steht nicht für das bekannte Auto, sondern es ist das lateinische Wort für es geschehe, es werde. Und Fiat-Geld entsteht im Prinzip oder besteht ohne einer Basis mit einem festen Wert. Das heißt, wenn man Geld heute hat, dann hat man keine Eintauschverpflichtung zu einem festen Wert, wie es zum Beispiel Gold ist, sondern das Geldsystem basiert einzig und allein auf Vertrauen. Das ist unser Geldsystem, wie es wir heute kennen, einzig und allein Vertrauen. Und das hat natürlich schon auch gewisse Gefahren mit sich gebracht. Das Wichtigste, was einmal zum Bemerken ist, seitdem es das Fiat-Geld gibt, wird Geld gedruckt ohne Ende. Da sieht man hier die Grafik in grün. Das betrifft jetzt die Einlagen der deutschen Banken. Das ist gestiegen von 0,004. auf 4 Billionen Euro sind die Einlagen gestiegen. Das heißt, es ist ein starker Anstieg natürlich der Geldmenge. Und wichtig ist immer auch zu verstehen, jedes Geld hat immer einen Gegenspieler. Das heißt, so viel Geld im Umlauf ist, gleichzeitig gibt es genauso viele Kreditforderungen. Das ist immer ein Ausgleich. Das heißt, wenn man davon redet, die Schulden steigen, dann wissen wir, auch das Geldvermögen steigt. Es hat immer ein Gegenspiel, es ist immer eine ausgeglichene Bilanz. Dadurch müsste man einmal grundsätzlich oder könnte man grundsätzlich einmal meinen, dann ist ja eh im Prinzip wurscht, ob es mehr oder weniger Geld gibt, wenn es gleichzeitig gleich viele Kreditforderungen gibt. Das muss sich ja irgendwo aufheben. Das Problem ist natürlich die Verteilungsgerechtigkeit. Das heißt, es ist ungleich verteilt, wo das Vermögen ist. Entschuldigung. Und es ist natürlich auch ungleich verteilt, wo die Kredite sind. Wir wissen, die Staaten sind verschuldet. Zu dem kommen wir nachher auch noch sehr häufig. Wir wissen, die 50 Prozent der Bevölkerung hat sehr, sehr wenig vom Finanzvermögen. Die ein Prozent der Superreichen hat sehr viel prozentual. Hier gibt es ein starkes Ungleichgewicht, wie das Ganze verteilt. Und das hat in der Vergangenheit leider Gottes auch sehr oft durch bestimmte Maßnahmen, die getroffen wurden im Steuersystem, hat schon begonnen beim Ronald Reagan in Amerika, ist dann übergeschwappt auch nach Europa. Das heißt, da wurden die gewissen steuerlichen Grundpfeiler auch dahingehend geändert, dass diese Vermögensverschiebung eigentlich zugenommen hat, dass immer weniger mehr haben und mehr weniger. Aber das wäre ein eigenes Thema, das werden wir heute nicht so stark besprechen. Wichtig ist der Zusammenhang der Geldmenge mit der Inflation. Und da gibt es unterschiedliche Meinungen. So wichtig das ganze Thema ist, so uneindeutig ist es immer wieder. Die Mehrheit der Ökonomen sieht zum Beispiel bei der Inflation einen anhaltenden Preisanstieg. Steigen die Preise, heißt das, das ist Inflation. Eine Minderheit der Ökonomen sieht in der Inflation das Aufblähen der Geldmenge im Vergleich zur Menge an Gütern und Dienstleistungen. Das Wort Inflation heißt auf Lateinisch Inflatio. Das Aufblähen, das Aufblähen der Geldmenge. Also das Wort würde eigentlich beschreiben, das Aufblähen der Geldmenge. Und da habe ich hierher geschrieben den Autor Raimund Brichter, der das in seinem Buch sehr nett beschreibt. Ich habe das in anderen Webinaren auch schon hergezeigt. Die Wahrheit über Geld, sehr empfehlenswert. Ich komme dann auch später noch einmal im Zuge der Finanzkrise 2008 auf dieses Buch zu sprechen. Hier wird es eben genau beschrieben. Er sieht das Aufblähen der Geldmenge als Ursache. Der Preisanstieg ist eine mögliche Folgewirkung. Er beschreibt es im Prinzip mit dem Vergleich. Das Fieber ist das Ansteigen der Geldmenge, die Grippe ist das Ansteigen der Geldmenge und wenn es dann zum Fieber kommt, dann sieht man den Preisanstieg. Das hat einen Zusammenhang, die Krankheit mit der Auswirkung, aber das Entscheidende ist, dass mit einer steigenden Geldmenge im Prinzip schon alles vorbereitet ist, dass der Geldwert sinkt durch die Inflation und dass das Geld einfach entwertet wird. Die Geldmenge vor 2013, weil das Buch ist schon 2013 rausgekommen, also es ist nicht sehr aktuell, was ich da in den Händen habe, aber grundsätzlich alles sehr spannend. Die Geldmenge vor 2013 ist um rund 7% gewachsen, das durchschnittliche Wirtschaftswachstum nicht einmal halb so hoch. Demnach betrug die Differenz per Definition, die Inflation, auch schon vor 2013 über 3%. Wenn man andere Statistiken sieht, dann sieht man, dass in dieser Zeit die Inflation meistens um 1,5 bis 2 Prozent gestiegen ist und nicht um 3 Prozent. Damit, so die Aussage von Raimund Brichter, wäre die Inflation auch 2013 schon längst da gewesen. Der Grund, warum die steigende Geldmenge nicht zu einer Inflation geführt hat, ist ausschließlich darin zu begründen, weil eben das Geld nicht in den Marktwirtschaft investiert wurde, sondern es wurde gehortet. Es wurde nicht ausgegeben. Und wenn das Geld nicht ausgegeben wird, dann führt es auch nicht zwangsläufig zu einer Inflation. Genau, wie ich vorher gesagt habe, die Grippe ist die erhöhte Geldmenge, die ist schon lange da, das Fieber, der Preisanstieg sollte folgen. Und ja, das kennen wir vielleicht ja auch schon, es ist ja die Inflation. Nach meinem Dafürhalten, also ich habe das oft. Dass ich mit Kunden gesprochen habe über das Risiko Inflation und dass man schauen muss, dass man beim langfristigen Geldanlegen den Inflation ausgleichen muss, damit ich den realen Wert des Geldes erhalten kann, war im Prinzip bis 2020 nicht so in den Köpfen verankert. Das Thema, das war nicht so präsent, bis es eben dann 2020, 2021 zur Inflation geführt hat. Und dieses Bild vielleicht als Brückenbauer, die Gefahren der steigenden Geldmenge kann man so sehen wie eine alte Ketchupflasche. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt an diese alte Ketchupflasche. Jüngere Teilnehmerinnen von euch wahrscheinlich nicht. Jahrgang 1972, wie ich bin oder plus minus in dem Dreh herum. Die werden das noch kennen. Und das Problem bei dieser Ketchup-Flasche war tatsächlich immer, man hat es umgedreht und das Ketchup ist einfach nicht aus der Flasche rausgegangen, man hat da immer wieder draufklopfen müssen, man hat draufklopft, viermal, fünfmal, sechsmal und irgendwann ist ein ganzer Schwall auf dem Teller gewesen, viel zu viel, das wollte man gar nicht haben. Und das ist dann das Problem, das hat man dann nicht mehr wieder zurückstopfen können in die Flasche, sondern das hat man halt dann entweder oder man hat es einfach auf den Teller gelassen. Aber es war schwer zu dosieren. Und genauso ist es bei den Maßnahmen gegen Inflation. Das heißt, wenn die Grippe schon da ist, wenn schon so eine erhöhte Geldmenge da ist, dann sind die Gefahren einer Stadt kurzschnellen steigenden Inflation sehr, sehr hoch. Man braucht nur einen kleinen Auslöser, einen kleinen Klaps auf die Flasche und dann kann das sehr schnell überschwappen. Und so ist es dann eben auch passiert 2021 im Zuge der Corona-Krise. Es gibt natürlich immer irgendwo einen externen Auslöser. Es gibt einen kleinen Auslöser. Wo in dem Fall die Corona-Krise hätte auch was anderes sein können, kann auch in Zukunft etwas anders sein. Und wir wissen, Da ist dann die Inflation auch in Österreich bis zu 10% gestiegen. Jetzt ist es ja das Thema Inflation wieder relativ ruhig. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Thema wieder stärker kommen wird. Das wird wieder früher oder später. Wie gesagt, ich bin kein Prophet und ich kenne die Zukunft genauso wenig wie alle anderen. Aber einfach, weil jetzt die Zusammenhänge hier sind. Die Geldmenge ist derart gestiegen, dass es zwangsläufig früher oder später sich in Inflationären Zuständen ausleben wird müssen. Und die steigende Geldmenge ist ja durchaus nicht gewünscht, auch von Experten und Expertinnen. Das heißt, wenn Geld gedruckt wird, dann hat das meistens immer eine Ursache. Das war zum Beispiel, bevor das Bretton-Woods-Abkommen abgeschafft wurde. War ja auch der Grund der Vietnamkrieg in Amerika, der einfach finanziert hat werden müssen. Amerika hat nicht so viel Geld gehabt, wie sie gebraucht hätten. Und sie haben einfach Geld gedruckt, um den Krieg zu finanzieren, weil das war im Prinzip das einfachere Mittel. Man hat es in Kauf genommen, dass der Umrechnungskurs zum Gold dadurch verloren geht. Das hat man gemacht. Kurzfristig hat es kein Problem gegeben. Das heißt, die Kriegspläne haben durchgeführt werden können. Wenn das nicht gemacht worden wäre, hätten sie den Krieg gar nicht führen können in der Form. Man hat das einfach gemacht, um, das für die Amerikaner damals aus deren Sicht gesehen, Problem der Finanzierung des Krieges zu gewährleisten. Und genauso war es dann auch in der Zeit, zum Beispiel in der Finanzkrise. Auch in der Finanzkrise hat man die Geldmenge ganz stark erhöht, weil Liquidität in den Markt gefragt war, damit eben unser Geldsystem nicht zusammenbricht. Und das sieht man hier. Also hier sieht man die Auswirkungen der Bilanz der US-Notenbank, der Federal Reserve, im Zeitraum 2001 bis 2022. Auch die Grafik ist schon etwas älter, aber im Prinzip aussagekräftig. Und das Entscheidende an der Grafik ist Folgendes. Man sieht hier die steigende Geldmenge in Amerika. Der Haken nach oben, wo sie es im Prinzip verdoppelt hat. Das war eben die Finanzkrise 2007. Und da hat zum Beispiel dann der damalige Finanznotenbank-Chef der Federal Reserve, der Ben Bernicke, auch bekannt als Helikopter-Ben, weil er immer gesagt hat, wenn es sein sollte, dann produzieren wir einfach so viel Geld und wir fliegen mit dem Helikopter über die Menschen und werfen das Geld beim Fenster raus und es gibt nie eine Geldknappheit. Jede Krise kann so quasi verhindert werden, so waren im Prinzip seine Aussagen und deswegen wurde er so genannt. Und da hat er vor dem Kongress in Amerika eben gesagt, also der Präsident der amerikanischen Notenbank, Ben Wernicke, hat dem Kongress gesagt, die quantitativen Lockerungen, das heißt das Gelddrucken, dabei handelt es sich um eine vorübergehende Maßnahme. Erinnern wir uns, auch Nixon hat gesagt, bei der Aufhebung des Goldumrechnungskurses ist zu Beginn alles nur vorübergehend.
Das ist im Prinzip eine Wiederholung in der Geschichte, dass ungute Nachrichten, die man nicht gerne hört, ein bisschen gelindert werden können, indem man sagt, das ist nur vorübergehend. Schauen wir uns das mal an, wir müssen das machen, weil wir bedroht sind, weil unser Geldsystem bedroht ist. Deswegen müssen wir diese Maßnahme vorübergehend einsetzen und das machen wir dann schon wieder alles rückgängig. Und da wird natürlich der Glaube auch verbreitet, dass die das im Griff haben und das wieder rückgängig machen werden. Da könnte ich viele Beispiele aufzählen, die man mit demselben Muster erkennt. Deswegen muss man einfach vorsichtig sein, wenn wir heute irgendwelche Experten hören, was die sagen, wenn eine Veränderung eintritt. Und da hat er eben gesagt, bei der quantitativen Lockerung, bei dem Gelddrucken, handelt es sich um eine vorübergehende Maßnahme, welche nach Überwinden der Finanzkrise rückgängig gemacht wird. Das hat er gesagt 2011. Und dann sehen Sie den Verlauf, wie das dann weitergegangen ist bis 2022. Das heißt von einer Rückgängigmachung keine Spur. Wenn es einmal losgeht, dann kann man das Ganze sehr, sehr schwer stoppen. 2011 betrug die Bilanz der Fed 2,5, 2.500 Milliarden Dollar. 2022 waren es 8.860 Milliarden. In zehn Jahren war das über 250 Prozent mehr. Eine jährliche Erhöhung durchschnittlich um 13,5 Prozent. Wachstum der Geldmenge, die da passiert ist. Ja, und das ist jetzt eine Bombe, die da entstanden ist in den letzten Jahrzehnten, die irgendwie entschärft werden muss. Und zwar die Bombe besteht in der Kombination der gesamten Geldmenge. Die Geldmenge wird beschrieben mit M1, M2, M3. Wir haben hier die M2-Geldmenge verwendet, weil wir haben diese Grafik von der Privatinvestor Spezialreport 2022 übernommen. Und das ist im Prinzip auch die entscheidende Größenordnung. Aber da gibt es auch unterschiedliche Meinungen unter den Fachleuten. Und da sieht man wieder, gilt jetzt für Amerika, 4,92 Billionen Geldmenge 2001. In der Kombination, dass die Zinsen damals sehr hoch waren bei 6% und die Amerikaner eine Verschuldung gehabt haben von 55,8 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt gerechnet. Das heißt, man muss da natürlich immer dann schauen, wie sind die Staaten, die ja letzten Endes für sehr viel Sicherheit sorgen sollten, wenn es ums Geldsystem geht, wie sind denn die finanziell so aufgestellt, wie groß darf das Vertrauen in diese Institutionen sein und wo könnten gewisse Gefahren drohen. Dann war die Finanzkrise 2008, 2009, schon begonnen 2007, aber ausgelebt 2008, 2009. Die Zinsen wurden gesenkt, die Schulden sind gestiegen, die Geldmenge stark gestiegen. Corona, die Geldmenge hat sich verdoppelt, 15 Billionen. Die Zinsen sind gefallen und die Schulden zum Bruttoinlandsprodukt sind sehr stark gestiegen. Und im Frühjahr 2022 haben wir quasi fast eine Nullzinspolitik gehabt. Die Schulden zum Bruttoinlandsprodukt sind noch stärker gestiegen und 21,8 Billionen Dollar. Das heißt, auch in dem Zeitraum ist die Geldmenge um 7,7 Prozent per anno gestiegen. Und das Problem ist hier natürlich, das Verhältnis der Staatsschulden, wenn die Zinsen wieder steigen, dann steigt natürlich auch die Verpflichtung der Zinsrückzahlungen für die Staaten. Und da muss man das natürlich schon genau im Auge behalten, wie es hier den Staaten finanziell geht in unserem Fiat-Geldsystem. Und da schauen wir uns kurz an die Staatsverschuldungsquoten, die Schuldenquoten. Wir haben ja zum Beispiel auch wieder, wie der Euro eingeführt wurde oder bevor der Euro eingeführt wurde, hat es diese Maastricht-Grenze oder die Maastricht-Kriterien gegeben. Wiederum nur dafür, dass der Geldwert stabil bleibt. Und da hat es zwei Feststellungen gegeben. Er hat gesagt, ein Staat darf sich nicht mehr als 60% verschulden in Bezug auf das Bruttoinlandsprodukt und pro Jahr darf man nicht mehr als 3% Neuverschuldung machen. Das heißt, man muss nicht die Schulden zurückführen, von dem ist gar keine Rede, sondern die Neuverschuldung, die oben drauf kommt, darf nicht mehr als 3% sein. Was ich ein bisschen eigenartig finde, weil im Verhältnis zum Ziel der Inflation, das bei 2% liegt, wenn ich 3% Neuverschuldung machen darf, dann führt es automatisch zu einer stärkeren Verschuldung, aber das sei einmal dahingestellt. Ja, und die Grafik zeigt hier eben Deutschland, den Euroraum und USA, wie die in der Schuldenquote beisammen sind. Deutschland liegt bei 63 Prozent, Verschuldungsgrad zum Bruttoinlandsprodukt, der Euroraum bei 90 Prozent, Österreich in etwa bei 85 Prozent und einige Länder wie Italien, Frankreich, Griechenland sowieso, die liegen weit darüber. Und auch die USA hat eine stark steigende Staatsverschuldung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Die Maastricht-Kriterien, die Maastricht-Grenze, die ja im Durchschnitt bei allen Staaten der Eurozone nicht 60% überschreiten dürfte, ist bei Weitem gebrochen. Um 50%, also mit 90% ist man um die Hälfte quasi drüber, als man sollte. Aber niemand kümmert sich im Prinzip. Also das sind Grenzen, die hier festgelegt wurden, um Vertrauen in unser Geldsystem zu erhalten, damit die Menschen, die Bürgerinnen Vertrauen haben in ein stabiles Geldsystem. Diese auferlegten Grenzen werden permanent gebrochen, Systeme werden permanent gebrochen. Aber irgendwie ist es dann doch so, dass das in der Bevölkerung eigentlich hingenommen wird oder bis jetzt keine größeren Auslöser entstehen. Der Maastricht-Vertrag wurde 1992 gegründet, habe ich schon gesagt, 60% Schulden, Obergrenze, 3% Neuverschuldung. Und 1970 hat Österreich, das bezieht sich auf Österreich, die Zahlen da herunten, 3,4 Milliarden Staatsverschuldung gehabt. Das waren 15% des Bruttoinlandsprodukts. 2025 waren es schon 400 Milliarden Euro. 82% des Bruttoinlandsprodukts ist eine Steigerung um das 117-fache in 55 Jahren oder 9% per anno. Das heißt, die Verschuldung ist um 9% gestiegen. Ist schon erschreckend, was da eigentlich so passiert. Und das wiederum zurückzuführen ist auf das Vertrauen. Jeder Österreicher, jede erwerbstätige Österreicherin hat im Durchschnitt Staatsschulden von 90.000 Euro und muss dafür im Jahr Zinsen zahlen von 1.700 Euro. Das wird auf uns. Wir müssen das ja, alle arbeitstätigen, erwerbstätigen Menschen in Österreich müssen das ja irgendwo auch finanzieren. Das ist der Rucksack, den wir mittragen und der hoffentlich irgendwann einmal in den Griff bekommen. Es gibt zusätzlich auch noch Staatshaftungen, es gibt Zahlungen für die Pensionszuschüsse in Höhe von 58 Milliarden Euro. Das heißt, das sind alles noch zusätzliche Probleme, die hier gar nicht in der Statistik aufscheinen. Also da schaut es im Prinzip eigentlich nicht sehr rosig aus, das möchte man im Prinzip damit sagen. Ja, und im Prinzip kommen wir jetzt eh schon Richtung Finale. Wie schaut es jetzt aus? Der Handelskrieg durch die USA angezettelt hat eine Ursache, beziehungsweise wird es halt von Donald Trump immer so erwähnt. Es geht darum, er möchte dieses Leistungsbilanzdefizit, das die USA verstärkt erlitten hat. Man sieht es hier in der blauen Linie. Die USA hat einen Verlust. Im Leistungsbilanzsaldo ist sie quasi negativ um 3,9 Prozent des Bruttoinlandsproduktes und Deutschland, Japan oder China haben hier einen Verlust. Und das will der Donald Trump verhindern. Da möchte ich an der Stelle vielleicht verweisen auf ein sehr interessantes Video, ein Beitrag von Hans-Werner Sinn. Der Hans-Werner Sinn ist vom ehemaligen Chef des Deutschen IFO-Institutes. Der hält regelmäßig Vorträge. Und auf YouTube werden die aufgezeichnet und die kann man sich anschauen. Und es ist wirklich toll, wenn man sich diese Informationen einmal gönnt, dass man da einmal genauer reinschaut. Die sind meiner Meinung nach sehr gut erklärt. Und hier kann man dann wirklich die Zusammenhänge auch sehr gut erfassen. Und er hat eine durchaus kritische Haltung zu vielen Themen, die nicht immer dem Mainstream entsprechen. Meiner Meinung nach kann er es immer sehr, sehr gut begründen und hat auch dieses Standing bei Ökonomen, die auch seinem Weg da durchaus immer wieder was abgewinnen können. Und er sagt zum Beispiel, wenn es um die Leistungsbilanz geht, muss man es immer unterschiedlich betrachten. Die volkswirtschaftliche Betrachtung und die betriebswirtschaftliche Betrachtung. In den Medien und so weiter kommt immer die betriebswirtschaftliche Betrachtung in den Vordergrund. Die heißt, viel exportieren ist gut. Die volkswirtschaftliche Betrachtung müsste eigentlich heißen, wenn ein Land Waren und Dienstleistungen importiert, die unsere Gesellschaft, die Konsumentin, der Konsument bekommt, jetzt habe ich noch ein anderes Wort gesucht, Entschuldigung, dann hat das einen Mehrwert für die Volkswirtschaft, für die Gesellschaft hat es einen Wert, wenn wir viele Waren aus dem Ausland konsumieren können, weil es dadurch unseren Wohlstand steigert. Wenn wir günstige Produkte aus China oder aus Asien bekommen, dann wird unser Wohlstand gesteigert. Direkt haben wir keinen Vorteil, wenn viel Waren exportiert werden. Die Unternehmen, die natürlich in das Ausland Waren exportieren, die profitieren natürlich von dem Export und indirekt natürlich auch wieder wir als Konsumentinnen und Konsumenten, weil wir einen sicheren Arbeitsplatz haben. Also das hängt schon alles zusammen. Aber einfach einmal aus der Betrachtung zu sehen, dass ein Leistungsbilanzdefizit nicht immer negativ sein muss, weil man ja Waren und Dienstleistungen aus einem Drittland konsumiert, wo man selber nichts leisten muss, außer dass man Geld gibt. Da werden wir in der Zusammenfassung, werde ich euch dann den Link schicken zu dem aktuellen Vortrag von Hans Werner sehen, wo das im Detail erklärt wird. Fakt ist, und da sind Sie, glaube ich, alle einig, Zölle behindern den Handel und ein geringerer Handel macht uns alle ärmer. Das heißt, ein Handel für Zölle hat in der Geschichte der Wirtschaft noch nie langfristige Vorteile gebracht. Auch vor dem Abkommen des Bretton-Woods-Systems hat es Zölle gegeben, hat es Währungsabwertungen gegeben, um den Export anzukurbeln. Das war ein Wettrennen, der unterm Strich für alle schlecht war. Und der zu Verwerfungen geführt hat und der die Situation nicht unbedingt verbessert hat. Und deswegen ist eben Bretton Woods gegründet worden, um den Handel zu erleichtern, um hier nicht irgendwelche Zölle oder etwas zu haben, das erschwert, sondern um den Wohlstand der Gesellschaft zu vermehren. Abbau der Handelsbeschränkungen, eine Vereinheitlichung der Wechselkurse. Dass das einfach einfacher wird. Das waren alles gute Ziele, die Konstruktion war leider Gottes nicht so gut, dass es gehalten hat, aber die Ziele waren im Prinzip gut. Meistens ist es so, dass wenn eine große Krise war, wie zum Beispiel die Weltkriege, dann ist man ja ein bisschen besonnener und nachher kann man hier auf Basis des Geschehens der Alles, was so an Tragik geschehen ist, sind die Leute halt dann doch bereit und vernünftig, auch wirklich eine gute Lösung gemeinsam zu erzielen. Und jetzt hat man irgendwie eher so das Gefühl, man ist wieder in der Zeit, vor dem Bretton-Woods-Abkommen befindet man sich. Und es ist natürlich die Gefahr hier, dass tatsächlich etwas passiert. Und ja, in der jüngsten Vergangenheit, in den letzten Wochen, ist ja schon einiges passiert. Die Aktienkurse sind gefallen, die Ursachen sind sinkende Gewinne oder man geht davon aus, dass die Gewinne der Wirtschaft einfach sinken durch die ganzen Erschwernisse, die hier gemacht werden, durch die Unsicherheit, die entsteht. Zölle ja, Zölle nein, in welcher Höhe, wer kann mit wem dann doch vielleicht irgendeinen Deal ausmachen? Und so weiter. Das ist für die Aktienkurse kein sehr guter Moment, aber auch Anleihenkurse speziell in Amerika sind gefallen und hier ist die Ursachenforschung nicht so klar. Und der Hans-Werner Sinn sagt hier in seinem letzten Interview, das ich eben gehört habe, oder nicht nur Interview, sondern es war ein Vortrag irgendwo in der Schweiz, dass ein Zahlungsausfall der USA tatsächlich im Raum stehen könnte und dass hier tatsächlich offizielle Aussagen zu lesen und zu hören sind, wo die Amerikaner meinen, dass sie die steigende Staatsverschuldung, die sie haben, nicht selber irgendwie bedienen möchten, sondern hier im Prinzip es darauf ankommen lassen wollen, dass wirklich nicht alles bedient wird oder dass eben Schuldverschreibungen von Anleihen, kurzlaufende Schuldverschreibungen umgehen. Geändert werden in langlaufende und somit die Rückführung dieser Anleihen zeitlich hinausgezögert wird. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was da in den nächsten Wochen und Monaten daherkommt. Und für euch alle möchte ich nur das mitgeben, wenn es in den Nachrichten etwas hört, es passiert etwas vorübergehend, wir müssen das, wir müssen etwas ändern, wir müssen etwas einführen, damit die Interessen der USA bewahrt werden oder solche Aussagen, dann sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Wie kann man sich in so einer Zeit aufstellen und wie kann man bei der Geldanlage sich auf so etwas vorbereiten? Fakt ist einmal, diese Grafik kennt ihr vielleicht schon, ich erkläre es nochmal ganz, ganz schnell. Wichtig ist einmal generell immer die Inflation mit zu berücksichtigen und vielleicht im Hinterkopf zu behalten, steigende Geldmenge ist die Grippe und die Inflation ist dann das Fieber. Und die steigende Geldmenge haben wir schon. Wir haben viel mehr Geld gedruckt im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Das heißt, es könnte jederzeit wieder einen Blob nach oben machen, wo die Inflation nach oben. Wir haben das von den 1980er Jahren, sieht man hier, eine 15.000 Euro Einmalzahlung. Welcher Gewinn hätte erwirtschaftet werden müssen, damit der reale Wert des Geldes erhalten geblieben wäre. Und da hat man immer Inflationsraten gehabt von circa 2 Prozent, das Ziel der Europäischen Zentralbank. Und dann ist es 2021 brutal angestiegen, 10 Prozent. Jetzt ist es wieder ein bisschen ruhiger. Aber wie gesagt, man weiß nicht, wohin da die Reise gehen wird. Hätte man das Geld auf dem Sparbuch gehabt, hat man in den Jahren 1980 bis zum Jahr 2000 mit den Zinsen noch relativ eine gute Abgeltung der Inflation bekommen. Das heißt, hier war der Inflation überschaubar. Mit zunehmender Zeit ist die Schere auseinandergegangen, speziell seit Anstieg der Inflation. Und bei gleichzeitig sehr niedrigen Zinsen haben wir real wirklich sehr, sehr viel Geld verloren. Das heißt, bei 15.000 Euro Einlage im Sparbuch hat man heute zwar nominell einen Gewinn von ca. 13.000 Euro, man bräuchte aber einen Gewinn von 33.000 Euro, das heißt, man hat real 20.000 Euro Verlust eingefahren. Das kann stärker werden, wenn man längerfristig das Geld nicht braucht, ist wahrscheinlich aus diesem Grund das Sparbuch nicht das optimale Instrument, um hier wirklich das Geld so aufzubewahren, dass es auch nicht weniger wird. Und wenn man sich anschaut, den Vergleich Aktien, Gold und Immobilien. Das heißt, in Blau habe ich Aktien, in Gelb habe ich die Gold und in Rot die Immobilien. Dann sieht man einfach, in den letzten 45 Jahren habe ich einfach mit Aktien netto nach Abzug aller Kosten und Steuern, wenn man es kosten- und steuereffizient gemacht hat, mit der Nettopolizze steuereffizient, provisionsfrei. Ohne Provisionen, dann hat man hier tatsächlich sehr, sehr hohe Gewinne netto nach Abzug aller Kosten erzielen können. Wichtig, immer schauen auf die Kostensteuereffizienz. Wenn man das nicht gemacht hat, war 50% des Geldwertes verloren, nur durch teure oder steuerineffiziente Produkte. Das heißt, immer auf die Kostensteuereffizienz achten. Das sollte nur am Rande angemerkt sein, weil das ist nicht Thema heute. Aber man hat aus 15.000 Euro 1,4 Millionen Euro Gewinn gemacht und man hat hier an der Weltwirtschaft partizipiert, wo man mit den Gewinnen den Realwertverlust ausgleichen konnte. Bei Gold in Gelb gesehen. Gold ist ja sehr stark angestiegen, speziell in den letzten Monaten, aber auch in den letzten Jahren seit 2007, 2008, also seit der Finanzkrise, ist Gold stärker gestiegen als Aktien. Nur Gold ist halt gar nicht gestiegen von 2080 bis 2005 und deswegen ist hier langfristig betrachtet Gold nicht wirklich so hoch in der Rendite, aber trotzdem den Inflation hat man sehr gut ausgleichen können mit knapp 5% Rendite in diesem Zeitraum. Und mit Immobilien hat man auch den Inflation ausgleichen können. Schauen wir uns den kurzfristigeren Bereich an, die letzten 20 Jahre. Hier hat Gold wesentlich einen höheren Anstieg als Aktien. Aktien in Blau, Gold in Gelb, Immobilien in Rot. Das ist ein konkreter Immobilienfonds. Immobilien sind immer ein bisschen schwierig zum Darstellen der Werte. Bei Gold und bei globalen Aktien ist es wesentlich einfacher, weil täglich handelbar und tägliche Kurse. Was bedeutet eigentlich dieser Anstieg bei Gold? Dieser extreme Anstieg. Das könnte schon ein Hinweis darauf sein, dass viele Marktteilnehmer hier Angst haben vor gewissen Abwertungen unseres Geldes durch Inflation oder vielleicht, wie der Hans-Werner Sinn eben in seinem Vortrag sagt, dass es tatsächlich zu einem Zahlungsausfall kommen könnte in der USA. Und wenn das passiert, dann wird das natürlich Konsequenzen haben auf die anderen Industrienationen, auf unser Geldsystem im Allgemeinen, weil es das in der Form seit der Nachkriegszeit so noch nicht gegeben hat. Für mich ist es klar, das ist ein weiteres Indiz dafür, dass man gut diversifizieren soll. Dass der Glaube, dass ein Sparbuch das Geld wertsicher ist, das möchte ich dadurch noch einmal mehr infrage stellen. Wichtig ist, dass man speziell Geld, das man längerfristig nicht benötigt, kurzfristig kaum in den Aktienmarkt investieren, aber Geld, das man zu zehn Jahren voraussichtlich nicht benötigt oder für die Pensionszahlung verwenden möchte, das sollte tatsächlich diversifiziert werden in unterschiedliche Anlageklassen und in der Vergangenheit hat man es im Prinzip immer so gehabt, dass auch bei Währungsreformen, wenn es ganz schlimm kommen sollte, wenn es wirklich zu Währungsreformen kommt, wie ich vorher angesprochen habe, 1945 oder 1947, dass man hier Immobilien oder Gold oder der Wert von Unternehmen, da habe ich keine Einbußen gehabt. Das habe ich im Prinzip immer, der Sachwert, der wurde einfach mit der neuen Währung 1 zu 1 umgetauscht. Aber der Geldwert, den ich gehabt habe am Sparbuch oder bei Anleihen, das wurde oft mit 1 zu 3 oder 1 zu 10, sogar wie es in Deutschland war, umgetauscht. Und hier habe ich schon ein gewisses Ausfallrisiko, das man hier einfach mitbedenken sollte. Wenn man da eins und eins zusammenzählt und da ein bisschen tiefer reinschaut, dann ist die Gefahr da. Und wichtig ist, es kommt dann sehr, sehr schnell. Das kann sehr, sehr schnell kommen. In der Vergangenheit, wenn so etwas passiert ist, waren das immer Wochenenden, wo dann etwas verkündet wurde. Das wurde still und heimlich vorbereitet. Und dann war es plötzlich so, man ist vor vollendete Tatsachen gestanden. Ja, habe ich nur eine Grafik. Das ist im Prinzip jetzt Sparbuch, Anleihen, Aktien. Da sieht man einfach die Stärke in der Rendite von Aktien. In einer Geldsystemkrise werden natürlich auch die Aktienmärkte fallen. Das ist ganz, ganz klar. Aber das Schöne ist bei Aktienmärkten, dass die ihr Potenzial haben auf Erholung. Ich habe das bei anderen Webinaren schon gezeigt. Ich möchte es zum Schluss vielleicht noch ganz kurz herzeigen. Börsen und Aktienkurse haben den Vorteil, die verhalten sich wie ein Gummiband. Das heißt, wenn wirklich etwas passiert, eine Systemkrise passiert, dann reagieren die Börsen sofort. Das mögen wir eigentlich nicht, weil dann kommt es sehr schnell zu Wertschwankungen. Wenn es rauf geht, haben wir kein Problem, aber wenn es runter geht, dann sehen sehr viele ein großes Problem darin. Aber der Vorteil ist, es bricht nicht. Das heißt, das Gummiband ist dehnbar. Und wenn viele Angst haben und Aktien verkaufen oder Liquidität brauchen, dann fallen die Kurse einfach von mir aus bis ins Bodenlose. Das können auch wie in der Weltwirtschaftskrise 90 Prozent sein oder in der Finanzkrise 50 Prozent. Das tut weh, das ist dramatisch, das will man nicht. Aber es bricht nicht. Die Elastizität der Börse nicht habe, sondern einen Holzstock, den habe ich heute nicht dabei, habe ich bei anderen Webinaren schon gehabt. Und es kommt ein Druck auf einen Holzstock drauf, der bewegt sich nicht, aber wenn der Holzstock bricht, dann ist es zerbrochen und dann muss ich wirklich einen Verlust in Kauf nehmen, wie ich schon erwähnt habe, bei Währungsumstellungen, bei Währungsreformen, Umtauschverhältnis. 1 zu 10 und dann ist es so, dann ist der Verlust realisiert, da habe ich keine Chance mehr, dass der Wert wieder nach oben kommt, wie hier beim Gummiband in Form von Aktien. Und das zeigt hier zum Beispiel auch diese Aktienkurve bei der Dotcom-Blase im Jahr 2000. Gefahren sind 50% gefallen, es hat sich wieder erholt. Finanzkrise gefallen, wieder erholt. Wenn wir hier eine neue Währung bekommen hätten 2008, dann wäre das einfach in der neuen Währung, wären die Gehälter bezahlt worden, hätten wir in einer neuen Währung unsere Dienstleistungen und Güter gekauft, das kann man ersetzen. Das ist der Vorteil, wenn ich in sogenannte Sachwerte investiere. Sachwerte wie Immobilien, Unternehmen in Form von Aktien oder eben auch Edelmetalle wie zum Beispiel Gold. Anleihen und das scheinbar sichere Sparbuch hat diese Funktionalität nicht. Hier ist man angewiesen, dass das System hält und das System ist aufgebaut auf Vertrauen. Und wenn man eben das Vertrauen nicht mehr da ist, dann kann es einfach brechen und das sollte man einfach mitnehmen. Ja, das war es aber jetzt schon von meiner Seite. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich an der Stelle. Ich freue mich, wenn wir uns persönlich vielleicht irgendwo sehen oder hören bei einem Termin, bei einer Beratung oder bei einem Webinar. Wir machen auch vielleicht diese Vorankündigung jetzt schon bei der Gewinnmesse im Oktober. Wir werden dann nochmal darauf hinweisen, sind wir wieder live, dieses Mal sogar mit einem Stand, sind wir beide Tage dort. Wir werden ein kleines Team von uns dort vor Ort haben. Bei der Gewinnmesse im Oktober kann man uns auch einmal persönlich treffen in Wien. Dazu gibt es auch Informationen. Und jetzt höre ich aber auf zum Blabbern. Vielen herzlichen Dank, wunderschönen Abend und danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.